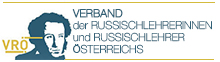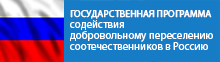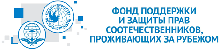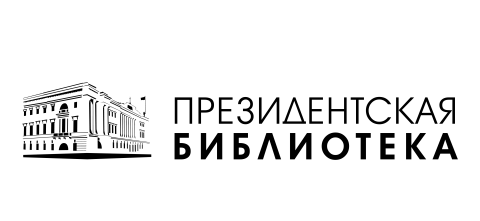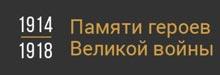Internationaler Tag des Denkmalschutzes: Schloss Skanavi und seine Geschichte bis heute
Die Geschichte des Hauses, in dem sich das Russische Kulturinstitut befindet, beginnt mit der Bebauung des Stadtteils Ende des XIX. Jahrhunderts. Eines der anstelle eines alten Gartens entstandenen Grundstücke auf dem zukünftigen Platz, der 1898 nach dem in der Nähe wohnhaften Komponisten Johannes Brahms benannt wurde, kaufte die wohlhabende Wiener Familie Scanavy. Die Wohnhäuser auf dem Brahmsplatz sind reich dekorierte Gebäude, die mit Balkonen, Erkern und Dachgeschossen geschmückt sind. Diesen Architekturstil bezeichnet man in Wien gewöhnlich als Historismus oder als Wiener Ringstraßen-Stil, im Russischen findet man eher die Bezeichnung „Eklektizismus“.

Mit den Bauarbeiten des Palais Scanavy wurde der Wiener Architekt Rudolf Dick beauftragt, der durch seine Villen von Rothschild im Randbezirk von Wien Hohe Warte und in Reichenau in Niederösterreich berühmt wurde. Neben R. Heiber, E. Fassbender, A. Görlich und der Firma „Kaupla und Orgelmeister“ hat R. Dick einen bedeutenden Beitrag zur Entstehung des modernen architektonischen und urbanistischen Bildes vom Brahmsplatz geleistet. (Er hat auch das Palais von Egon Müller, Brahmsplatz 3, gebaut). Die Archi- tekten-Baumeister des Palais Scanavy waren Oskar Laske und Viktor Fiala.

Gemäß dem Gesamtkonzept für die Bebauung des Platzes wurde unter der Leitung von R. Dick das fünfstöckige Gebäude im Barockstil errichtet. Besonders interessant war der reiche Fassadendekor, leider haben viele Details die Erschütterungen des XX. Jahrhunderts nicht überstanden. Man kann sie nur mehr auf alten Ansichtskarten sehen.

Der Haupteingang ist jedoch in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben. Die Türflügel des Eingangs sind Beispiele der Wiener Schmiede- und Gießereikunst Ende des XIX. Jahrhunderts, ebenso die originalen, geschmiedeten Treppengeländer im Inneren des Gebäudes.


Im Foyer, im heutigen Kinosaal und im Konferenzsaal sind Reliefs aus Gips erhalten geblieben, die nach der neuerlichen sorgfältigen Restaurierung (2016) wieder ihre ursprüngliche Pracht haben, die für die Wiener Großbürgerhäuser charakteristisch war. 

Im Konzertsaal ist noch die originale Bemalung erhalten, wie z. B. das Wappen der Familie Scanavy. Die Familie hatte griechische Wurzeln und war in Wien seit der Mitte des XIX. Jahrhunderts bekannt. Das Familienoberhaupt, Nikolaus von Scanvy der Ältere (verst. 1889), hat sein beträchtliches Vermögen durch Handels- und Finanztätigkeit erworben und wurde in den österreichischen Adelsstand erhoben. Sein Neffe, Nikolaus Scanavy der Jüngere1 (1851-1936), wurde zum griechischen Konsul in Wien ernannt und er war es auch, der den Bau des Hauses in Auftrag gab. Nikolaus konnte das Vermögen der Familie noch vergrößern, wurde mit einigen Orden und Aus-zeichnungen gewürdigt, insbesondere auch mit dem Franz-Joseph-Orden, dem griechischen Erlöser-Orden, dem serbischen Takovo- und dem osmanischen Micidi- Orden sowie dem persischen Sonnen- und Löwenorden. Er empfing 1911 den griechischen König Konstantin I. im Rahmen dessen offiziellen Besuches in Wien.

Die original gemalten Wappen der Familie Skanavi

Fragment des Kaufvertrages 1947
Die erste Hälfte des Hauses verkaufte Theodor Scanavy bereits 1947 an die Sowjetunion. Die langfristige Miete der zweiten Hälfte war mit dem Vorkaufsrecht des restlichen Gebäudeteils verbunden. Nach dem Tod von Hans Scanavy im Jahr 1956 wurden die noch zu seinen Lebzeiten begonnenen Verhandlungen mit dem Kauf der zweiten Haushälfte durch die Sowjetunion 1966 ab-geschlossen. In den Räumlichkeiten des Palais wurden die Zeitschrift „Sowjetunion heute“ („Советский Союз сегодня“), Vertretungen von Sovexportfilm und TASS sowie die Österreichisch-Sowjetische Freund-schaftsgesellschaft untergebracht.

Fragment des Kaufvertrages 1966

\Wiener Kurier 23. Dezember 1946\
Die Gesellschaft wurde im Mai 1945 auf Initiative des Wiener Arztes, Humanisten und Philosophen Dr. Hugo Glaser gegründet, der 30 Jahre ihr Präsident war. „Die Gesellschaft zur Festigung der kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen mit der Sowjetunion“ wurde am 2. Juni 1945 als demokratische Nichtregierungsorganisation gegründet und sollte die Beziehungen zwischen der UdSSR und der Republik Österreich auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kultur festigen. 
Wilhelm Kaufmann. Portrait Doktor Hugo Glaser. 2. Hälfte XX Jh.
Seit 2008 ist das Russische Kulturinstitut in Wien Vertretung der Föderalen Agentur für die Angelegenheiten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, für Fragen der im Ausland lebenden Mitbürger und für internationale humanitäre Zusammenarbeit in der Republik Österreich. Das Russische Zentrum für Wissenschaft und Kultur in Wien arbeitet auf der Grundlage eines Abkommens zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung der Republik Österreich. Republik Österreich über kulturelle Zusammenarbeit.
Das Russische Kulturinstitut wurde innerhalb einiger Jahrzehnte zu einem Treffpunkt hervorragender russischer Künstler, Wissenschaftler und Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Bildung und Kultur mit dem Wiener Publikum. In den Sälen des Instituts werden regelmäßig Konzerte, Austellungen, кинопоказы, Vorträge, Vorlesungen, Präsentationen, literarische Lesungen, Konferenzen. Die Zusammenarbeit mit Kulturvertretungen anderer Länder spielt ebenfalls eine große Rolle in der Tätigkeit des Zentrums.

Музыкальный салон - место проведения уникальных концертов известных мировых исполнителей классической музыки

Ein Element des ursprünglichen Holzdekors im Musiksaal
Das Russische Kulturinstitut verfügt über eine Bibliothek und eine Filmothek, deren Fonds mehr als 26.000 Werke enthalten. Die Bibliothek hat eine große Auswahl an russischer klassischer und moderner Literatur sowie Periodika. Außerdem besteht die Möglichkeit, im Lesesaal der Bibliothek elektronische Bücher und Dokumente der B.-N.-Jelzin-Präsidentenbibliothek (St. Pb.) online zu lesen.
Das Institut spielt aufgrund seiner vielseitigen kulturellen Tätigkeit und anderer Möglichkeiten für einen offenen Dialog zwischen Österreichern und Russen eine große Rolle bei der Pflege der Kontakte, die Österreichern die vielseitige russische Kultur näherbringt und zu einem besseren gegenseitigen Verständnis zwischen den beiden Völkern beiträgt.
Videorundgang durch die Ausstellung zum 45-jährigen Bestehen des RKI in Wien (2020) "RKI in Wien. Fäden der Geschichte"
- Häuser-Kataster der k.k. Haupt- und ResidenzstadtWien. 2 Aufl. Hrsg, von Joseph Lenobel. Wien; Leipzig 1911.
- Häuser-Kataster der Bundeshauptstadt Wien. Hrsg, von J. Wolfgang Salzburg. Wien 1929.
- Todfallsaufnahme: Scanavi Niolais, gest. 1936, zul. Wh. Wien 4, Brahmsplatz 8. GZ 2A 1926/36.WStLA 2.3.1.5 BG Margareten, A4/2 — 2A: Scanavi Nikolaus, gest. 1936, zul. wh. Wien 4, Brahmsplatz 8.
- Dokumentation des Russischen Kulturinstituts Wien: Schreiben vom 09.05.1959, 15.05.1959, 08.05.1975 bzgl. der Eigentumsrechte und des Bauzustandes des Palais Scanavy.
- Wien Kulturgut: Brahmsplatz, Brahmsplatz 8.
- Architektenlexikon Wien: Rudolf Dick.
- WienGeschichteWiki: Einträge zu Brahmsplatzviertel, Brahmsplatz, Rudolf Dick.
- Österreichische Kunsttopographie. XLIV: Die Kunstdenkmäler Wiens. Die Profanbauten des III., IV. und V. Bezirkes. Hrsg, von Geza Hajos, Walther Brauneis u.a. Wien 1980.
- DEHIО-Handbuch der Kunstdenkmäler Österreichs. Wien: II. bis IX. und XX: Bezirk.
- Bearb. V. Wolfgang Czerny u.a. Wien 1993.
- Historisches Lexikon Wien. Hrsg, von Felix Czeike. Band 1,1-Da. Wien 1992. Band 4. Le-Ro. Wien 1995.
- Renate Wagner-Rieger, Geschichte der bildenden Kunst in Wien. 3. Geschichte der Architektur in Wien. Wien 1973.

 Tel.: 01 / 505 18 29
Tel.: 01 / 505 18 29